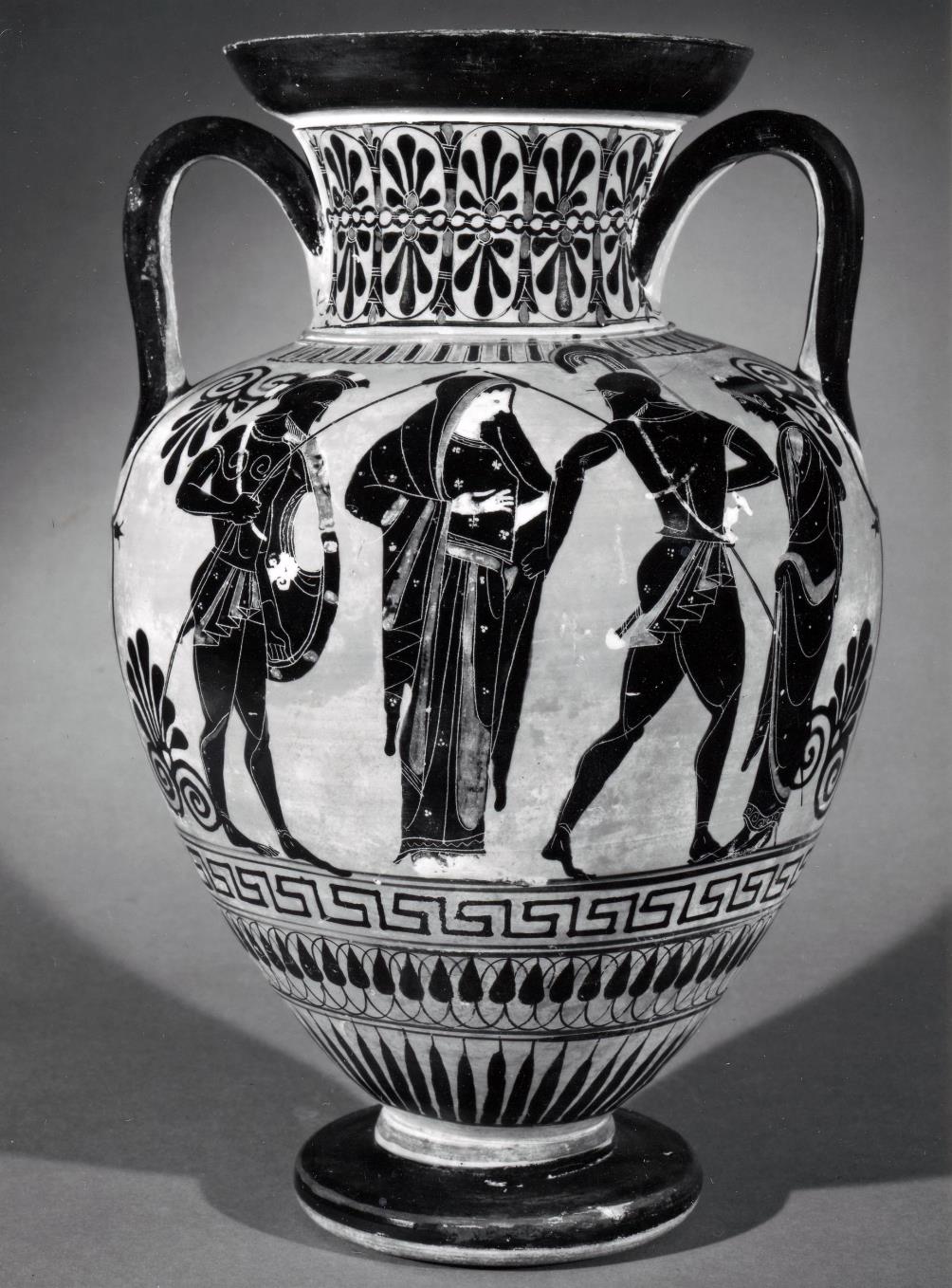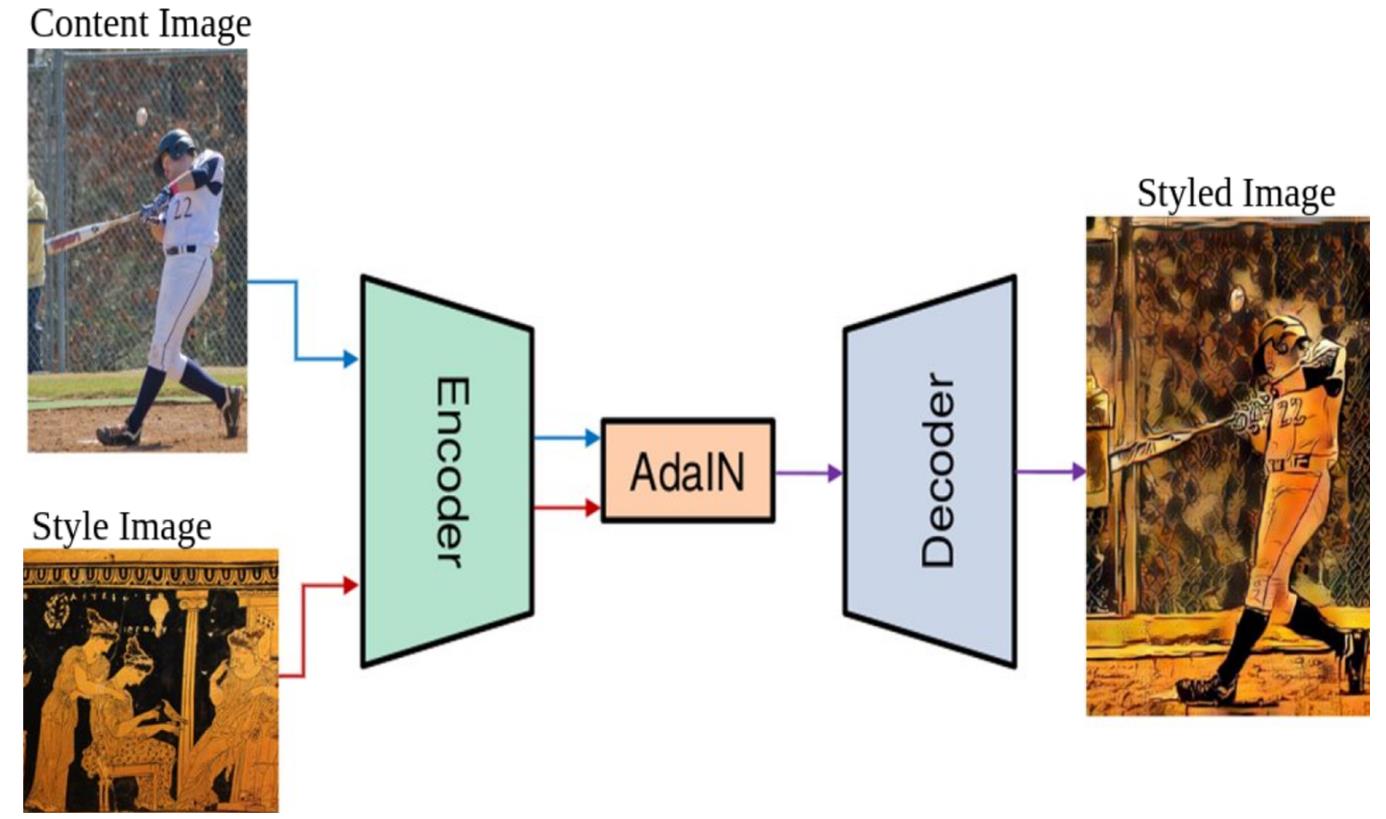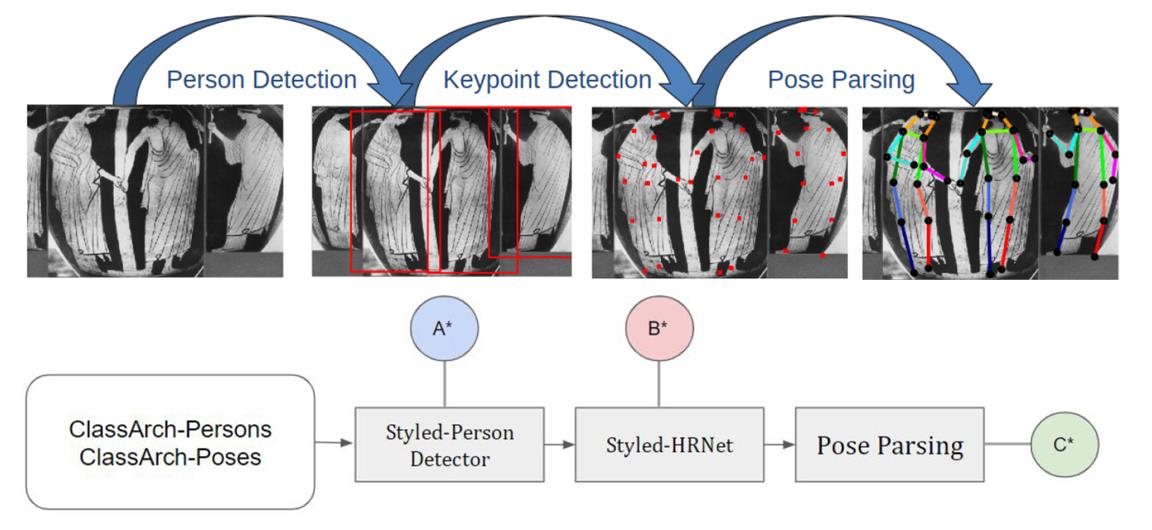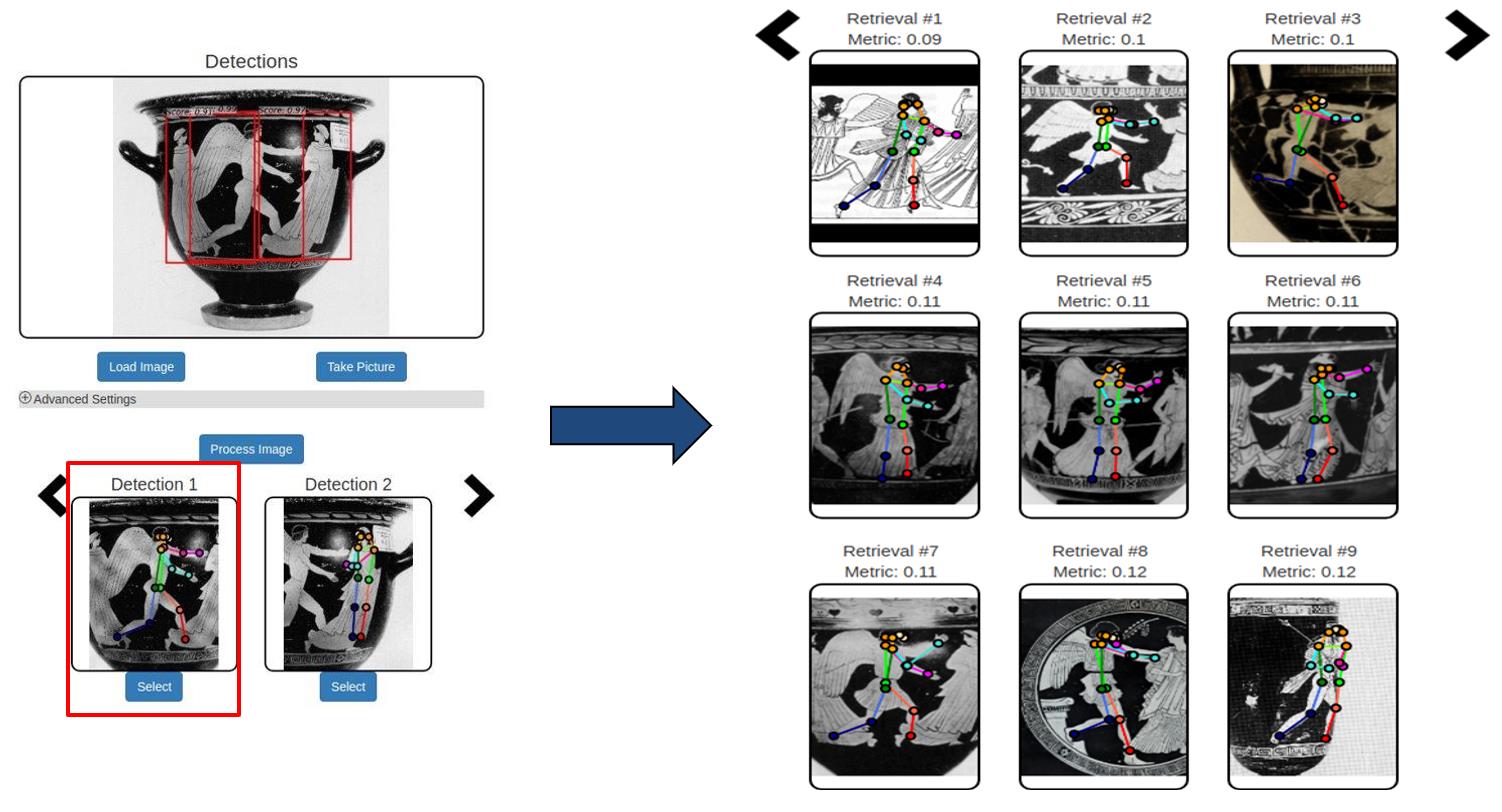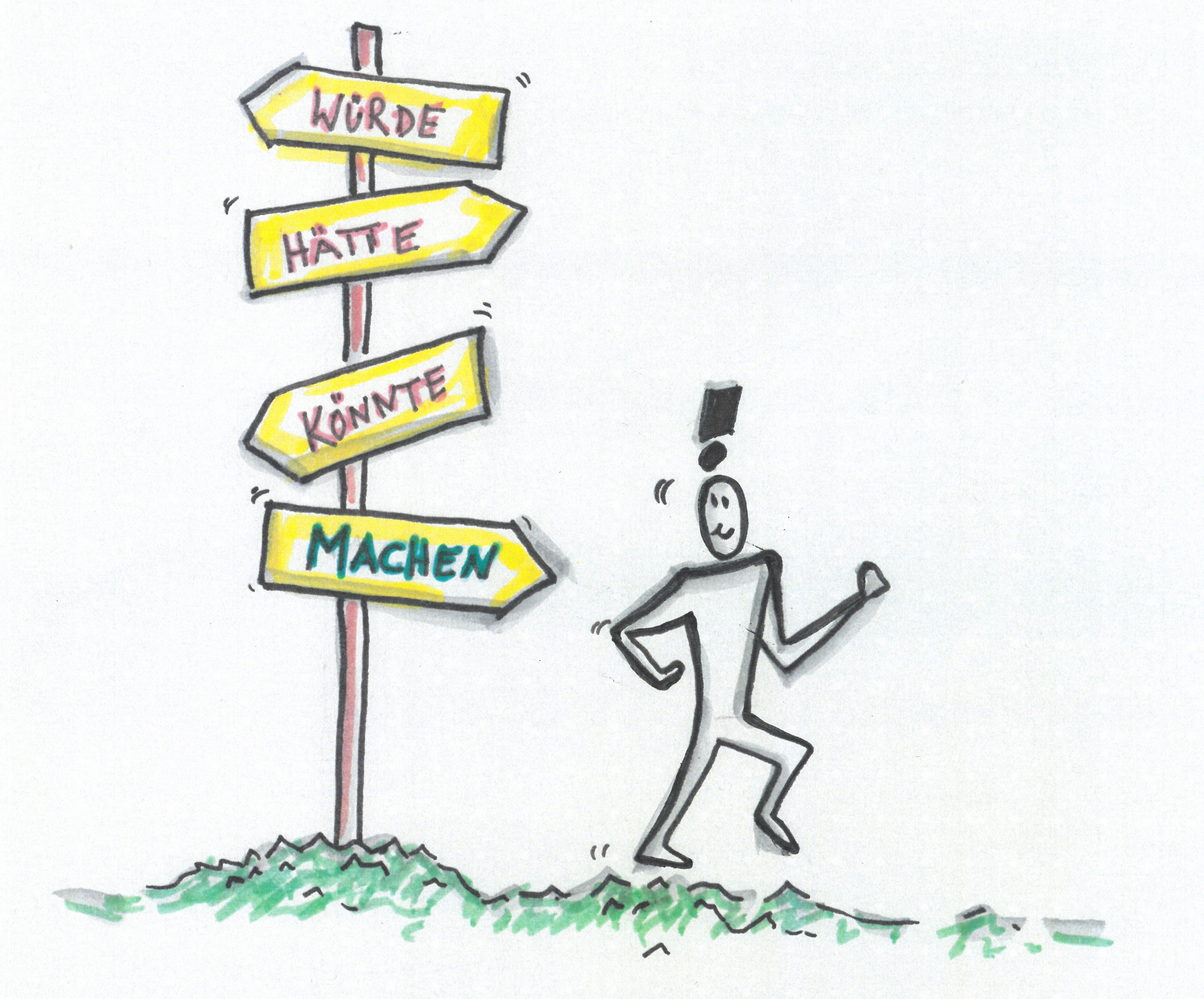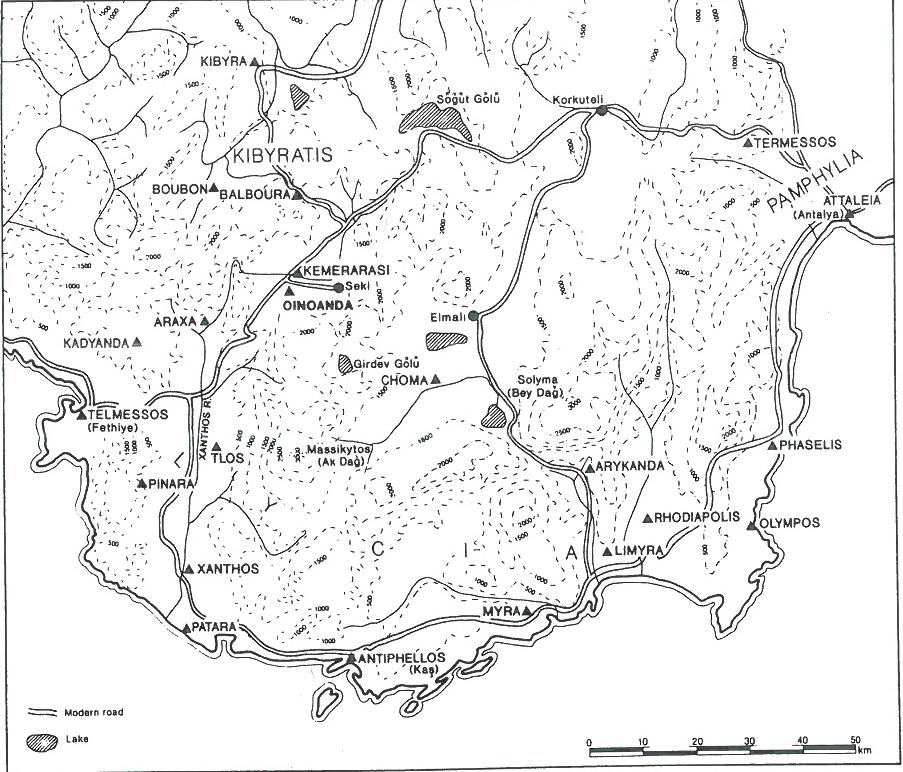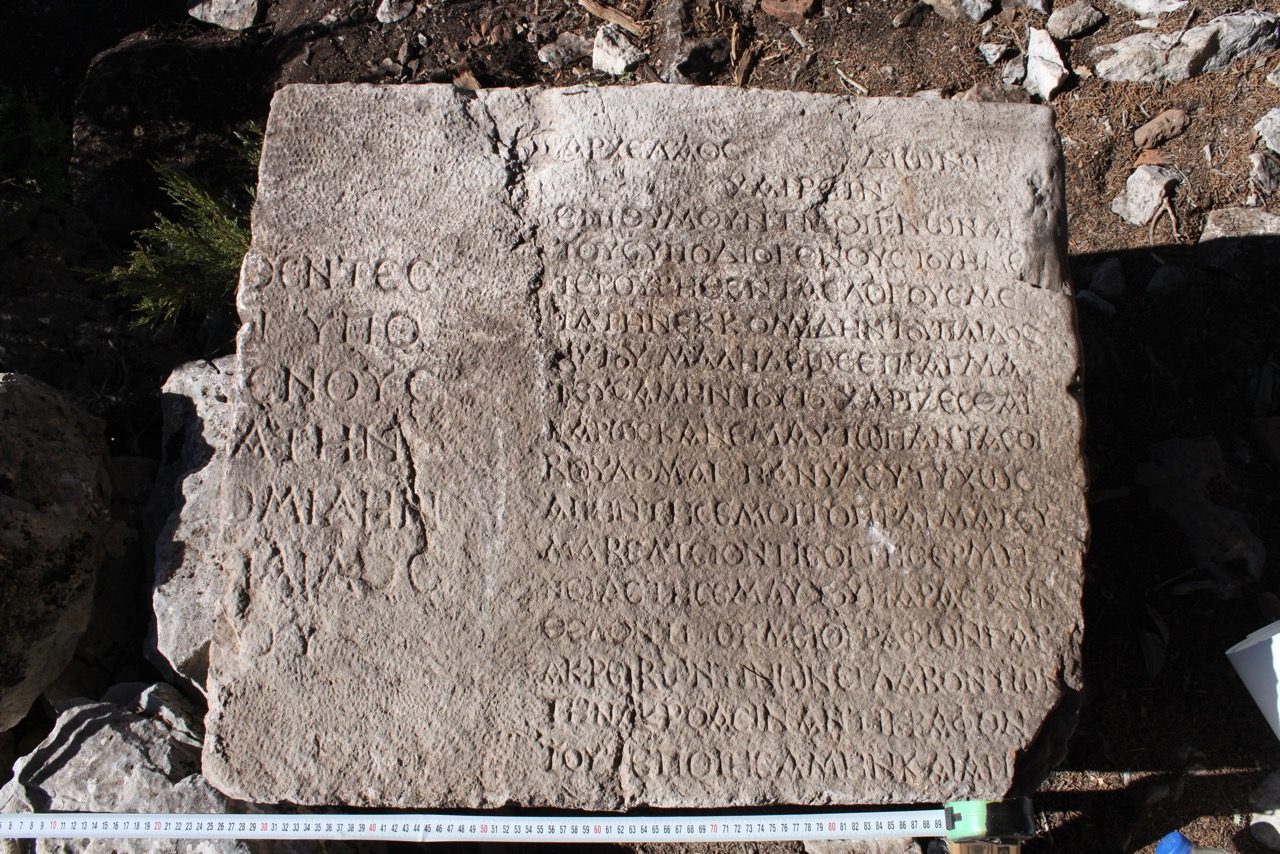Es kursieren viele Anekdoten zu Sokrates. In einigen spielt auch Xanthippe, die Ehefrau des Philosophen, eine zentrale Rolle. Eine davon möchten wir hier kurz vorstellen. Sie ist in zwei antiken Texten überliefert, die beide aus der Kaiserzeit stammen. Die Geschichte wird in der Varia Historia des im fortgeschrittenen 2. Jh. n. Chr. schreibenden Claudius Aelianus erzählt und ebenso in den Deipnosophisten des ungefähr gleichzeitigen Athenaios. Es geht darum, wie Xanthippe auf ein Geschenk reagiert, das Alkibiades dem Sokrates zukommen lässt. Hier der Text aus der Varia Historia:
πλακοῦντα ὁ Ἀλκιβιάδης μέγαν καὶ ἐσκευασμένον κάλλιστα διέπεμψε Σωκράτει. ὡς οὖν ὑπὸ ἐρωμένου ἐραστῇ πεμφθὲν [τὸ] δῶρον ἐκκαυστικὸν τὸν πλακοῦντα διαγανακτήσασα κατὰ τὸν αὑτῆς τρόπον ἡ Ξανθίππη ῥίψασα ἐκ τοῦ κανοῦ κατεπάτησε. γελάσας δὲ ὁ Σωκράτης ῾οὐκοῦν᾽ ἔφη ῾οὐδὲ σὺ μεθέξεις αὐτοῦ.᾿ εἰ δέ τις οἴεται περὶ μικρῶν με λέγειν λέγοντα ταῦτα, οὐκ οἶδεν ὅτι καὶ ἐκ τούτων ὁ σπουδαῖος δοκιμάζεται ὑπερφρονῶν αὐτῶν, ἅπερ οὖν οἱ πολλοὶ λέγουσιν εἶναι κόσμον τραπέζης καὶ δαιτὸς ἀναθήματα. (Varia Historia 11, 12)
Einen Kuchen schickte Alkibiades dem Sokrates, einen großen und sehr schön zubereiteten. Da es ein Geschenk war, das von einem Geliebten an einen Liebhaber geschickt wurde, um das Feuer der Leidenschaft zu schüren, warf Xanthippe, die in der ihr eigenen Art ungehalten wurde, den Kuchen aus dem Korb und zertrat ihn. Sokrates lachte und sagte: „Also wirst auch du nichts davon mithaben!“ Wenn jemand der Meinung ist, dass ich über Kleinigkeiten spreche, weiß er nicht, dass auch hieraus der ernsthafte Charakter zu erkennen ist, der all jenes verachtet, was die Masse für Schmuck des Tisches und Zierde des Mahles hält (Übers. Brodersen 2018, leicht modifiziert).
Auf die emotionale Seite der Szene gehen Aelianus und Athenaios gar nicht ein, doch ist sie grundlegend für das Verständnis.
Sokrates und Alkibiades sollen ein nicht nur freundschaftliches, sondern auch homosexuelles Verhältnis gehabt haben. Von dem Kuchen heißt es ausdrücklich, dass er ein Geschenk war „um das Feuer der Leidenschaft zu schüren“.
Alkibiades hat sich offenbar Gedanken darüber gemacht, was Sokrates gefallen könnte. Einen Kuchen verleibt man sich ein, er bietet einen sinnlichen Genuss, ist außerdem etwas sehr Persönliches. Kuchen bzw. Essen haben etwas mit körperlichen Wohlbefinden zu tun, andere Gegenstände wären viel weniger intim. Insofern ist Xanthippes Reaktion gegen den Kuchen besonders heftig. Sie wirft ihn nicht hin, weil sie Kuchen generell für unwichtigen Tand hielte, sondern weil sie gekränkt und eifersüchtig ist. Schließlich untergräbt Alkibiades die erotische Beziehung, die sie mit ihrem Ehemann Sokrates hat.
Die Fassung zu behalten, wenn man sich über etwas ärgert – denn auch Sokrates hat sich im tiefsten Innern sicher im ersten Moment über den verlorenen Genuss geärgert –, bedeutet immer einen gewissen inneren Aufwand, nämlich das Reflektieren der eigenen Gefühle und das Ringen um Selbstbeherrschung. Die Fassung zu verlieren bedeutet gerade keine Mühe, sondern ist das spontane Nachgeben eines inneren Impulses. Xanthippe und Sokrates sind Prototypen zweier konträrer Charaktere: Xanthippe folgt impulsiv ihren Emotionen, Sokrates hat ein hohes Maß an Selbstbeherrschung und Reflektiertheit erreicht. Der Kern der Anekdote liegt in der Gegenüberstellung der unterschiedlichen Verhaltenswesen der Ehegatten. Die Anekdote will nicht etwa moralisierend den ernsthaften Charakter des Sokrates loben noch geht es, wie Aelianus in einem zweiten Text nahelegt, um die Bedeutung des Sammelns unwichtiger Dinge wie Kuchen, sondern der Witz der Anekdote liegt darin, dass hinter Sokratesʼ trockenem Satz bei aller philosophischen Abgeklärtheit seine eigene (überwundene?) Sinnlichkeit durchschimmert.
Aelians Kommentar zu der Anekdote kommt überraschend, denn anscheinend geht es ihm nicht um den vordergründigen, menschlichen Aspekt der Geschichte. Vielmehr rechtfertigt er sich, indem er einen zukünftigen Leser tadelt, der nach der Relevanz dieser Anekdote fragen würde, und den Begriff des σπουδαῖος, des ernsthaften Charakters, ins Spiel bringt. Ein solcher nämlich würde billige Genüsse verachten. Dies mag sich vordergründig auf die Anekdote und den Kuchen beziehen: Sokrates steht über den Dingen und erachtet einen Kuchen gar nicht für würdig, um sich darüber aufzuregen. Sehr viel wahrscheinlicher jedoch meint Aelianus an dieser Stelle ganz unbescheiden sich selbst und interpretiert den „Schmuck des Tisches und Zierde des Mahles“ als intellektuelle Tischgespräche. Er selbst weiß eben, wie er sich im Kontext eines Festmahles von der Masse (οἱ πολλοί) durch seine Raffiniertheit und Belesenheit abheben kann, indem er andere und vielleicht entlegenere Kostbarkeiten anbietet als die Erwarteten und Geläufigen. Dies lässt er auch daran deutlich werden, dass er mit seinen beiden letzten Worten (δαιτὸς ἀναθήματα) scheinbar beiläufig ein Homer-Zitat einwebt (Od. 1.152). Ein Spiel mit Worten also, wie es von einem Vertreter der Zweiten Sophistik durchaus zu erwarten ist.
Dass eine solche Interpretation möglich ist, bestätigt sich, wenn wir diese Textstelle in einem weiteren Kontext betrachten. Als erstes ist in diesem Zusammenhang zu bemerken, dass die bunten Anekdotensammlungen aus der Antike, zu denen die Varia Historia gehört, oft ausdrücklich zusammengestellt wurden, um den Gästen eines Festmahles genügend geistreichen Gesprächsstoff zur Verfügung zu stellen (Plutarch, Tischgespräche 621c–d und Oikonomopoulou 2013).
Der zweite Text, in dem die Sokrates-Anekdote überliefert ist, findet sich in den Deipnosophisten des Athenaios. Dieses Werk steht nicht nur zeitlich sehr nahe an Aelians Varia Historia, sondern beschreibt auch tatsächlich ein solches Gelehrtengastmahl (Deipnosophistai), für das diese Sammlungen zusammengestellt wurden.
Πλακούντων δὲ ὀνόματα πολλῶν καταλεξάντων, ὅσων μέμνημαι τούτων σοι καὶ μεταδώσω. οἶδα δὲ καὶ Καλλίμαχον ἐν τῷ τῶν παντοδαπῶν συγγραμμάτων Πίνακι ἀναγράψαντα πλακουντοποιικὰ συγγράμματα Αἰγιμίου καὶ Ἡγησίππου καὶ Μητροβίου, ἔτι δὲ Φαίστου. ἡμεῖς δὲ ἃ μετεγράψαμεν ὀνόματα πλακούντων τούτων σοι καὶ μεταδώσομεν, οὐχ ὡς τοῦ ὑπ᾽ Ἀλκιβιάδου πεμφθέντος Σωκράτει. ὃν Ξανθίππης καταπατησάσης, γελάσας ὁ Σωκράτης ‘οὐκοῦν᾽, ἔφη, ‘οὐδὲ σὺ μεθέξεις τούτου.’ (Athen. 14, 643e–f)
Da sie die Bezeichnungen vieler Kuchenarten aufzählten, will ich dir diese – soweit ich mich entsinne – mitteilen. Ich weiß aber, dass Kallimachos in seiner „Aufstellung von Schriften aus allen Ländern“ auch Abhandlungen aufgeführt hat, die sich mit der Herstellung von Kuchen beschäftigen, und zwar von Aigimios, Hegesippos, Metrobios wie auch Phaistos. Wir werden dir nun diejenigen Bezeichnungen von Kuchen, die wir herausgeschrieben haben, auch mitteilen, nicht wie bei dem, der von Alkibiades an Sokrates geschickt worden war. Als diesen Xanthippe am Boden zerschmettert hatte, bemerkte Sokrates: „So wirst auch du davon nichts mitbekommen“. (Übers. Friedrich 2001, leicht modifiziert)
Auch Athenaiosʼ Zeilen enthalten ein geistreiches Wortspiel, noch dazu eines, das die Übersetzung nicht zum Ausdruck bringen kann: „μεταδώσομεν“ wurde hier zweideutig im Sinne von „mitteilen“ und „teilen“ gebraucht. Der Autor betont damit, dass er seinem Adressaten (Timokrates) nichts vorenthalten werde, ganz im Gegensatz zu Xanthippe, die ihrem Mann den Kuchen nicht gönnte.
Den modernen Leser mag es verwundern, dass Athenaios an dieser Stelle allen Ernstes sämtliche Kuchennamen referieren will, die im vorherigen Verlauf des Gastmahls der Deipnosophisten erwähnt wurden. Wir sind in Buch 14 und schon weit im Gastmahl fortgeschritten, denn die Nachtische sind nun an der Reihe, über die Pontianos, einer der Gäste, lange referiert hat. Nun will der Ich-Erzähler, also Athenaios, seine eigene Leistung unter Beweis stellen, die er dank seines Erinnerungsvermögens erbringen wird. Mit dem Hinweis auf Kallimachos rechtfertigt er sein Tun: Kuchen sind zwar keine Helden, doch das Kleine, Raffinierte, aber sehr Gelehrte kann sich durchaus im entsprechenden Zusammenhang mit dem großen, erhabenen Epos messen. Es galt also als größerer Fehler, etwas Subtiles zu übersehen und eine Schrift fälschlicherweise zu unterschätzen, als zu viel zusammenzutragen.
Wenn diese Interpretation stimmt, so kann sie auch ein anderes Licht auf weitere Aussagen des Aelianus werfen, die seine eigene Tätigkeit betreffen. Dazu wollen wir zum Schluss eine dritte Stelle kurz erwähnen. Im Prolog seiner anderen erhaltenen Anekdotensammlung, der De Natura Animalium, wendet er sich auch an zukünftige Leser und speziell solche, die seinem Werk kritisch entgegentreten könnten. Ihnen gibt er Folgendes zu bedenken:
ἐγὼ δὲ ἐμαυτῷ ταῦτα ὅσα οἷόν τε ἦν ἀθροίσας καὶ περιβαλὼν αὐτοῖς τὴν συνήθη λέξιν, κειμήλιον οὐκ ἀσπούδαστον ἐκπονῆσαι πεπίστευκα. εἰ δέ τῳ καὶ ἄλλῳ φανεῖται ταῦτα λυσιτελῆ, χρήσθω αὐτοῖς· ὅτῳ δὲ οὐ φανεῖται, ἐάτω τῷ πατρὶ θάλπειν τε καὶ περιέπειν· οὐ γὰρ πάντα πᾶσι καλά, οὐδὲ ἄξια δοκεῖ σπουδάσαι πᾶσι πάντα. εἰ δὲ ἐπὶ πολλοῖς τοῖς πρώτοις καὶ σοφοῖς γεγόναμεν, μὴ ἔστω ζημίωμα ἐς ἔπαινον ἡ τοῦ χρόνου λῆξις, εἴ τι καὶ αὐτοὶ σπουδῆς ἄξιον μάθημα παρεχοίμεθα καὶ τῇ εὑρέσει τῇ περιττοτέρᾳ καὶ τῇ φωνῇ. (De Natura Animalium, Prolog)
Indem ich dieses alles aber, so weit möglich, gesammelt und in die gewohnte Sprache eingekleidet habe, glaube ich einen ernstzunehmenden Schatz zustande gebracht zu haben. Wenn auch ein anderer diese Arbeit brauchbar findet, mag er sie benutzen; findet er sie nicht so, sei es doch ihrem [geistigen, Anm. Verf.] Vater gestattet, sie zu hegen und zu pflegen. Nicht alles scheint ja allen schön und nicht allen alles der ernsthaften Bemühung wert. Wenn wir aber erst nach vielen der Erstschöpfer und Weisen geboren sind, soll diese Zeitfolge der Anerkennung keinen Abbruch tun, solange wir nur auch selbst ein ernstzunehmendes Stück Bildungswissen mit gewählterer Untersuchung und Sprache bieten. (Über. Brodersen 2018, leicht modifiziert)
Auffallend ist die Aneinanderreihung von Begriffen, die mit dem σπουδαῖος (dem ernsthaften Charakter) aus der Sokrates-Anekdote in Verbindung gebracht werden können. Aelianus sieht seine Tätigkeit als diejenige eines σπουδαῖος, eines ernsthaften Wahrers des Wissens, der den wirklichen Wert erkennt, auch im Unscheinbaren.
Alexandra Trachsel, unter Mitwirkung von Luise Seemann und Thomas Ganschow
Literatur:
Brodersen K. (trad.), Ailianos, Vermischte Forschung, Berlin/Boston 2018.
Brodersen K. (trad.), Ailianos, Tierleben, Berlin/Boston 2018.
Ceccarelli P., Dance and Desserts: an Analysis of Book Fourteen, in D. Braund und J. Wilkins (Hrsg.), Athenaeus and his World. Reading Greek Culture in the Roman Empire, Exeter 2000, 272–291.
Oikonomopoulou K., Plutarch’s Corpus of Quaestiones in the Tradition of Imperial Greek Encyclopaedism, in J. König und G. Woolf (Hrsg.), Encyclopaedism from Antiquity to the Renaissance, Cambridge 2013, 129–153.
Friedrich C. und Nothers T., Athenaios, Das Gelehrtenmahl, Buch XI–XV, Teil 2: Buch XIV und XV, Stuttgart 2001.

Abb. 1: Herme des Sokrates. Neapel, Nationalmuseum.
Historisches Photoarchiv der Antikensammlung der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
http://www.aeria.phil.uni-erlangen.de/photo_html/portrait/griechisch/denker/sokrates/sokrat25.html